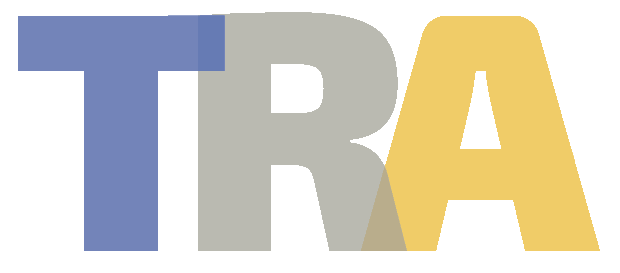Eröffnungsausstellung im P26
Die Ausstellung „Auf Spurensuche“ wird im P26, dem neuen Museums- und Ausstellungsgebäude der Universität Bonn, gezeigt. Der Eintritt ist frei.
Aufgrund der großen Nachfrage wird die Ausstellung bis zum 31. Mai 2025 verlängert.
Auf Spurensuche in den Museen und Sammlungen der Universität Bonn: Objektgeschichten
Universitätsmuseen und -sammlungen sind Wissenslabore. Sie sind Ergebnis und Grundlage für Forschung und Lehre in den unterschiedlichsten Fächern.
Die Sammlungen und Museen der Universität Bonn bewahren unzählige Objekte. Jedes hat eine eigene Geschichte. Um ihre Geschichten zu ergründen, begeben sich Forscher:innen auf Spurensuche und fragen: Wer hat die Dinge gesammelt und warum? Wurden sie gekauft, getauscht, geschenkt oder gar geraubt? Wie sind sie hierhergekommen?
Im Rahmen der Provenienzforschung klären Forscher:innen und Studierende, ob ein Objekt aus einem Unrechtskontext kommt. Sie versuchen ebenfalls, einen angemessenen Umgang mit sensiblen Dingen zu finden.
Die Ausstellung zeigt Forschungsergebnisse aus 25 Institutionen der Universität Bonn – spannende Objektgeschichten, die zum Nachdenken und Austausch anregen. Sind Sie neugierig geworden und kommen mit uns auf Spurensuche?

Diese Themen erwarten Sie in der Ausstellung:
Wie erforscht man die Herkunft und Geschichten von Objekten in Sammlungen und Museen?
Die Suche nach Spuren der Provenienz – der Herkunft, Geschichten und Wege eines Objekts –beginnt am Objekt selbst. Weitere wichtige Quellen für die Erforschung von Provenienzen sind Unterlagen zu den Objekten, die in den Sammlungen und Museen bewahrt werden. Sie geben Aufschluss darüber, wer vorherige Besitzer:innen oder Eigentümer:innen waren. Die Recherchen können in Archiven, Datenbanken und Publikationen fortgeführt werden, um die Geschichte eines Objekts und ihre Hintergründe genauer zu ergründen.
Von wem wurde was, wann, warum und unter welchen Umständen gesammelt? Wie wurden Objekte für Sammlungen erworben?
Auf diese Fragen gibt es nicht eine, sondern viele Antworten. Die Geschichten der über hundert Exponate in der Ausstellung geben Einblicke darin, auf welche Weisen Objekte für Sammlungen der unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachdisziplinen zusammengetragen wurden. Die meisten Objekte in den Sammlungen der Universität Bonn wurden durch Ankäufe, Schenkungen und Nachlässe sowie durch Tausche und Leihgaben erworben.
Wie sind die Sammlungen an der Universität entstanden und warum gibt es sie?
Bereits mit der Gründung der Universität Bonn 1818 entstanden die ersten Sammlungen von Objekten, Repliken, Modellen und Abbildungen. Sie wurden angelegt, um an den Objekten zu forschen und mit ihnen Wissen zu vermitteln. Universitäre Sammlungen dokumentieren frühere Forschungstätigkeiten und Lehrmittel und sind auch heute in die Lehre eingebunden und werden weiter erforscht – auch unter neuen Fragestellungen wie der nach der Provenienz.
Manchmal bleiben auch nach intensiver Spurensuche Fragen zur Herkunft und Geschichte von Objekten offen. Gerade in universitären Sammlungen fehlen oft systematische Aufzeichnungen zu Erwerbungen. Universitätssammlungen werden in der Regel von Wissenschaftler:innen betreut, die Expert:innen ihres Faches sind, aber keine museologische oder archivalische Ausbildung haben. Provenienzforschung versucht, die Geschichten von Objekten lückenlos zu rekonstruieren. Gelingt das nicht, müssen Unklarheiten offengelegt werden.
Bestimmte Dinge in Sammlungen, Museen, Archiven und Bibliotheken gelten als sensibel – so etwa sterbliche Überreste von Menschen wie Mumien, Schädel und anatomische Präparate sowie Objekte, die in Unrechtskontexten ohne Zustimmung betroffener Personen angeeignet wurden. Sensible Dinge bedürfen aus ethischen Gründen besonderer Umgangsweisen, weil sie in Beziehung zu Personen außerhalb der bewahrenden Institution stehen, beispielsweise zu Angehörigen von Herkunfts- und Urhebergesellschaften oder von früheren rechtmäßigen Eigentümer:innen.
Provenienzforschung wird im öffentlichen Diskurs vor allem in Zusammenhang mit Sammlungsgut, das in Unrechtskontexten angeeignet wurde, thematisiert. Dabei geht es meistens um NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut und um Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, also um Dinge mit sensiblen Provenienzen. Ist der Kontext des Erwerbs, der Aneignung, Herkunft, Herstellung oder Musealisierung eines Objekts aus ethischen Gründen als sensibel oder zumindest bedenklich einzustufen, prüft Provenienzforschung, ob und wem durch den Erwerb Unrecht widerfahren ist. Sie ist auch Voraussetzung dafür, gerechte und faire Lösungen für den künftigen Verbleib zu finden.
Wie geht man mit sensiblen und unrechtmäßig angeeigneten Dingen um? Wem gehören sie? Wer soll über ihren Verbleib und Nutzung entscheiden?
Sensible Dinge bedürfen sensibler Umgangsweisen. Sie stellen die Einrichtungen, die sie bewahren, vor besondere Herausforderungen. Viele universitäre Sammlungen und Museen stehen noch am Anfang dieser Auseinandersetzung. Um gerechte und faire Lösungen finden zu können, müssen sensible Bestände zunächst erfasst, dokumentiert, erforscht und öffentlich zugänglich gemacht werden. Hierzu leistet diese Ausstellung einen Beitrag. Eine gerechte und faire Lösung ist für jeden Einzelfall individuell und gemeinsam mit Erb:innen rechtmäßiger Eigentümer:innen bzw. Angehörigen von Urhebergesellschaften auszuhandeln.
Die Sammlungen und Museen der Universität Bonn
Die Universität Bonn besitzt über 40 Forschungs- und Lehrsammlungen und Museen an verschiedenen Fakultäten. Sie bilden die Vielfalt der Disziplinen ab: von A wie Akademisches Kunstmuseum über M wie Moulagensammlung bis Z wie Zoologische Sammlungen. Auch Archive und lebende Sammlungen wie die Botanischen Gärten gehören dazu. Die Bestände spiegeln Lehrziele und Forschungsschwerpunkte der jeweiligen Fächer und Institutionen in ihrer geschichtlichen Entwicklung wider. In all diesen Einrichtungen wird inventarisiert, dokumentiert und geforscht, zum Teil in (inter)nationalen Projekten. Einige vermitteln Forschungsergebnisse in Ausstellungen. In vielen Institutionen werden Objekte präpariert, restauriert und digitalisiert. Letzteres ist wesentlich für die Provenienzforschung, die – in unterschiedlichem Maße – in allen Sammlungen stattfindet. Je nach Grad der Erschließung der Sammlung stehen Forscher:innen dabei mitunter vor größeren Herausforderungen.
Museen und Sammlungen der Universität Bonn
- Ägyptisches Museum
- Anatomische Sammlung
- Akademisches Kunstmuseum
- Astronomische Sammlung
- BASA-Museum (Bonner Amerikas-Sammlung)
- Botanische Gärten
- Dentalhistorische Sammlung
- Franz Josef Dölger-Institut (Christliche Archäologie)
- Foto-Sammlung des Kunsthistorischen Instituts
- Goldfuß-Museum (Paläontologie)
- Institute for Medical Humanities (Medizinhistorische Bibliothek)
- Herbarium
- Kunstbesitz
- Mineralogisches Museum
- Moulagensammlung
- Paul-Clemen-Museum
- Sammlung der Abteilung für Asiatische und Islamische Kunstgeschichte (AIK)
- Sammlung des Zentrums für historische Friedensforschung (ZHF)
- Sammlung und Archiv zum Atlas der Deutschen Volkskunde (ADV)
- Vor- und Frühgeschichtliche Lehr- und Studiensammlung
- Universitätsarchiv
- Universitätsmuseum
- Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (ULB)
- Zoologisches Institut
- Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (Leibniz Institut)
Kooperationspartner
- Forschungsstelle Provenienzforschung, Kunst- und Kulturgutschutzrecht (Universität Bonn)
- Friedrich-Ebert-Stiftung
Aus den Museen, Sammlungen, Bibliotheken und Archiven der Universität Bonn:
Frank Förster (Ägyptisches Museum); Kornelia Kressirer und Frank Rumscheid (Akademisches Kunstmuseum – Antikensammlung der Universität Bonn); Stefanie Kürten und Julian van den Heuvel (Anatomische Sammlung); Jürgen Kerp (Astronomische Sammlung); Carla Jaimes Betancourt, Joaquín Molina und Karoline Noack (BASA-Museum (Bonner Amerikas-Sammlung)); Cornelia Löhne (Botanische Gärten); Ernst-Heinrich Helfgen (Dentalhistorische Sammlung); Hilja Droste (Fotosammlung des Kunsthistorischen Instituts); Elisabeth Enß (Franz Joseph Dölger-Institut zur Erforschung der Spätantike); Georg Heumann und Alina Winkler (Goldfuß-Museum); Thomas Joßberger (Herbarium); Christian Kaiser und Julia Letow (Institute for Medical Humanities); Sarah Moll (Kunstbesitz der Universität Bonn); Anne Zacke (Mineralogisches Museum); Kathrin Burauel und Lisa Perzynski (Moulagensammlung); Jan Decher, Marianne Espeland, André Koch und Claudia Koch (Museum Koenig Bonn – Leibniz-Institut für Analyse des Biodiversitätswandels); Friederike Kalb und Harald Wolter-von dem Knesebeck (Paul-Clemen-Museum); Simon Hirzel (Sammlung und Archiv zum Atlas der Deutschen Volkskunde); Oliver Kessler (Sammlung und Bibliothek der Abteilung für Asiatische und Islamische Kunstgeschichte); Hendrik Mechernich (Universitätsarchiv); Sandra Müller-Tietz, Niklas Pulte, Lotta Westdorf und Theo Wilken (Universitätsmuseum); Michael Herkenhoff, Tobias Jansen, Birgit Schaper und Manfred Weber (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn); Ernst Pohl (Vor- und Frühgeschichtliche Lehr- und Studiensammlung); Jonas Bechtold und Michael Rohrschneider (Zentrum für Historische Friedensforschung); Michael Hofmann (Zoologische Sammlung) sowie Rafael Andrade und den an unserer Lehrveranstaltung zu Beginn des Ausstellungsprojektes teilnehmenden Studierenden Lea Delißen, Marlies Happ, Richard Kaldenhoff, Shuangning Liu, Alina Mack, Patrick Marenda, Elisabeth Mollenhauer, Lusala Nzanza, Judith Steinig-Lange und Julian Wyss.
Außerdem danken wir folgenden Personen und Einrichtungen für ihre Arbeit und Unterstützung: Christopher Brennan (englisches Lektorat), Marcus Brien und Alyssa Crina Löffler sowie Katja Oeser (S.U.B. Kultur/bonnFM, Audiodateien), Gunar Peters und Ole Lentfer (Videoproduktion), Jean-Luc Ikelle-Matiba, Jutta Schubert und Sebastian Tews (Objektfotos), Anna Lukácsi (Plakatgestaltung), Jan Kleinmanns, Christian Prager und Esther Tenberg (3D-Modelle), Monika Clemens (Dez. 4), Dieter Roßbach (Transport und Service), Hausverwaltung der Universität Bonn, Schreinerei und Malerwerkstatt der Universität Bonn (Ausstellungsaufbau).
Für die Szenografie und professionelle Umsetzung der Ausstellungsgestaltung danken wir dem Team des Szenografiebüros chezweitz (Sonja Beeck, Barbara Weinberger, Mo-Ran Kilian, Claudia Besuch) und ihren Kooperationspartnern.
Einen ganz besonderen Dank möchten wir Sandra Müller-Tietz, Niklas Pulte, Lotta Westdorf und Theo Wilken für ihre großartige Unterstützung rund um das Entstehen der Ausstellung aussprechen!
Alma Hannig, Naomi Rattunde und Elizabeth Stauß
Veranstaltungen, Bildungs- und Vermittlungsangebote
Hier finden Sie in Kürze unser vielfältiges Begleitprogramm. Führungen können auf Anfrage gebucht werden. Für Schulen werden spezielle Führungen und Workshops angeboten.
Eröffnungsveranstaltungen
Eröffnung des Akademischen Jahres am 18.10.2024:
Im Anschluss an die feierliche Eröffnung des Akademischen Jahres wurde das neue Museums- und Ausstellungsgebäude P26 in der Bonner Fußgängerzone von der Universitätsleitung und zusammen mit allen Beteiligten und zahlreichen Gästen eröffnet.
Eröffnung der Ausstellung „Auf Spurensuche“ für das Publikum am 23.10.2024:
Am ersten Publikumstag, dem 23.10.2024, gab es tagsüber kostenlose Führungen durch die Ausstellung und eine offizielle Begrüßung durch das Kuratorinnenteam. Über 100 Besucher:innen nutzten an dem Tag die Chance, mit unseren Expert:innen ins Gespräch zu kommen: Alma Hannig, Georg Heumann, Tobias Jansen, Oliver Kessler, André Koch, Cornelia Löhne, Elisabeth Mollenhauer, Naomi Rattunde, Elizabeth Stauß, Alina Winkler, Anne Zacke.
Öffnungszeiten und Kontakt

Öffnungszeiten
Ausstellung „Auf Spurensuche“
Mo - Fr 10:00 - 18:00 Uhr
Sa - So 14:00 - 18:00 Uhr
Eintritt frei
Adresse
Knowledge Lab Uni Bonn (KLUB) im P26
Poststraße 26
Erdgeschoss
53111 Bonn
Diese Ausstellung wird gefördert von: